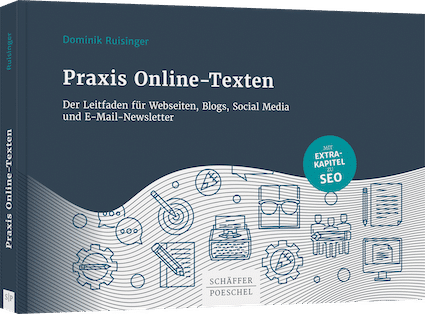by Dominik Ruisinger | 24.10.2022 | Blog
In den letzten 4 Wochen durfte ich 4 Vorträge halten: zu sehr unterschiedlichen Anlässen, zu sehr unterschiedlichen Themen, an sehr unterschiedlichen Orten. Doch meine Kernaussage war immer dieselbe: Das Ende von Social Media ist da, zumindest so wie wir Social Media bisher kannten. Warum New Friends künftig unsere Best Buddys ersetzen sollen, dies will ich in diesem Gedankenspiel etwas näher erläutern.
Gehen wir ein paar Jahre zurück – sagen wir zu einer Zeit, bevor gerade TikTok die Branche revolutionierte. Wir alle hatten unsere Facebook-, Instagram-, YouTube-, ja sogar XING-Accounts, öffneten (fast) täglich unsere Timeline und ließen uns von den Beiträgen unserer Freunde zum Lachen oder Weinen bringen, zum Fluchen oder Amüsieren oder einfach informieren. Dann kam die Werbung. Doch das war zu erwarten. Dann kam TikTok. Und plötzlich wurde alles anders.
Und nein, damit meine ich nicht die Idee von Kurzvideos. Nein. Denn dies war nix Neues. Aber: Die Freunde, das eigene Netzwerk, die persönlichen Verbindungen waren mit einem Schlag unnötig geworden. Wo einst Connections sowohl für die Inhalte als auch für die Sichtbarkeit der eigenen Inhalte sorgten, waren es plötzlich die Empfehlungen eines Algorithmus‘, der sich nicht mehr an bisherigen Verbindungen, sondern an Interessen orientierte.
Social Media: One-Hit-Wonder ohne Fans
Positiv gesagt: Mit einem Moment war es möglich, mit dem ersten jemals publizierten Video, besser TikTok, eine extreme hohe Sichtbarkeit zu bekommen, einen Run, oft ein One-Hit-Wonder, auf jeden Fall mit hohen Abrufzahlen. Weil der Algorithmus diesen Beitrag so schätzte, weil die gespielten Inhalte, die Hashtags, ja sogar der Sound auf der Plattform aktuell so beliebt waren. Und die eigene Community? Dieser eigene Fankreis spielte keine Rolle; okay, beim ersten Video gab es diesen eh noch nicht. Das heißt: Die algorithmische Beliebtheit des Contents hatte das menschliche Gesicht des Netzwerkes ersetzt.
Und was passierte? Gerade die jungen Menschen – und nur auf diese haben es die Netzwerke abgesehen, wie ich es kürzlich in einem anderen Gedankenspiel geschildert hatte – waren begeistert. Die App-Downloads und Aufrufe gingen durch die Decke, Instagram verlor beträchtlich an Sichtbarkeit und vor allem an Verweildauer, und Mark Zuckerberg brüllte verzweifelt: Wir müssen jünger werden – und dies auf allen Netzwerken. Gesagt, getan.
New Friends statt Best Buddies
Also verabschiedeten sich Instagram und Facebook von „unserem“ Social Media, also von den Inhalten und Interaktionen verbundener Freunde, Fans und Follower. Sie shifteten um zu einem von Algorithmen dominierten, auf Empfehlungen basierenden Modell der Content-Distribution – mit Fokus auf Video. So meinte Mark Z: „Eine der wichtigsten Veränderungen in unserem Geschäft besteht darin, dass soziale Feeds nicht mehr in erster Linie von den Accounts, denen man folgt, angetrieben werden, sondern zunehmend von KI, die Inhalte empfiehlt, die man auf Facebook oder Instagram interessant findet, selbst wenn man den Creatorn nicht unbedingt folgt.“
Diese Umstellung läuft auf Hochtouren, sodass laut Mark bis Ende 2023 der KI-Anteil schon 30 Prozent betragen soll. Und auch wenn Kylie Jenner, der Kardashian-Clan & Co. laut schrien: „Wir wollen die Bilder unserer Freundinnen und Freunde zurück“, blieben Zuck, Adam Mosseri & Co. hart: Die Welt verändert sich, und Instagram und Facebook müssen sich dem anpassen. Wobei sie mit dem Verändern natürlich TikTok meinten.
„Friend graphs can’t compete in an algorithmic world„
Plötzlich landeten wir überall in derselben Content-Blase, da sich die eingespielten Inhalte am bereits ausgespieltem und beliebtem Content orientierten. Wie langweilig. Warum sollten wir überall das Gleiche mittels der gleichen Formate, Filter, Sounds, Vorlagen posten und sehen? Natürlich wiesen uns die Plattformen eifrig darauf hin, dass wir weit mehr als unsere Blase erleben konnten. Aber erreichte dies uns?
Die Netzwerke lobten, dass wir auf diese Weise Menschen – Creators – besser erreichen könnten, die uns noch nicht kannten. Aber was war mit unseren Connections? Das Ganze wirkte plötzlich so, als würden wir von den Partys unserer Best Buddys ausgeladen werden und stattdessen zu wildfremden Partys geschickt werden, um neue Menschen kennenzulernen. Aber wollen wir das? Und verstehen wir unter dem Begriff „social“ nicht gerade auch die Beziehungspflege mit Friends? „Friend graphs can’t compete in an algorithmic world“, schreibt Michael Mignano in seinem bemerkenswerten und von mir bereits öfters zitierten Essay.
Unternehmen ab in den Extra-Feed
Was lernen wir daraus? Ja, das Ziel dieser TikTokification ist eindeutig: Menschen sind nicht mehr so wichtig. Die Recommendations der Algorithmen mit aktuellem Fokus auf Kurz-Videos bestimmen die Inhalte. Und die Posts unserer Friends & Followers? Die werden wie bei Facebook in die Neben-Feeds verbannt. Und die Inhalte unserer sorgfältig aufgebauten Gruppen? Landen ebenfalls in den Nebenfeed, den kaum jemand wahrnehmen wird.
Und die Seiten der Unternehmen und Institutionen, die über die Jahre so sorgfältig gefüttert worden waren, mit Inhalten, mit viel Zeit, mit intensivem Community Management und mit noch mehr Werbegeldern hochgezüchtet? Ja, auch diese bekommen ihren Extra-Feed – im Abseits. Und sind damit weg aus dem Aufmerksamkeitsfenster des Haupt-Feeds. Und damit auch der bisherigen Fans, Follower, Kundinnen, Partner, Interessenten.
Videos für die jüngeren, Ads für die Älteren
Hmmm, was soll ich denn jetzt als Unternehmen machen? „Schalte Ads“, schreien Facebook, Instagram & Co. „Mache Reels, Shorts und TikToks“, rufen die Social Media Coaches und Agenturen. Und wenn ich über kein gutes Videomaterial verfüge, zumindest nicht kontinuierlich? Pech gehabt. Und wenn meine – damned … – ältere Zielgruppe kein wirklicher Fan von Kurz-Videos ist? Bekommt sie trotzdem. Schade um sie. Zudem bleiben ja noch die Ads.
Aha, jetzt ist mir endlich klar, welche Idee dahintersteckt: die Jungen über Video-Content und angesagte Themen, Hashtags, Sounds, die Älteren über Ads. Ist das dann noch das bekannt-beliebt-bisherige Social Media? Wohl kaum. Es ändert sich einiges. Aber wie sagt man so schön: Wer sich nicht bewegt, der verliert – vor allem an Sichtbarkeit und Relevanz. Wer nicht sichtbar und damit findbar ist, der existiert für die meisten Menschen nicht. Zumindest für die anvisierte junge Zielgruppe.
Revival der integrierten Kommunikation
Damit wird immer klarer, wie die künftige Welt der Kommunikation aussehen wird. Social Media wird bei Zielgruppen, die nicht Generation Z oder Y heißen – und das ist zumindest bei uns die große Mehrheit –, nur noch eine vornehmlich werblich geprägte Nebenrolle spielen. Stattdessen erleben traditionelle Kanäle der digitalen Kommunikation wie Webseiten, E-Mail-Newsletter, Apps, aber auch SEO und SEA ein notwendiges Revival. Weil wir diese Menschen in einer von Algorithmen bestimmten und auf deren Empfehlungen beschränkten Welt ansonsten nicht mehr erreichen.
Ist das eine so große Umstellung? „The chaos at social networks is a reminder that any platform with that kind of power should never be your only – or even your primary – way of communicating with your audiences”, schreibt Allison Carter bei PR Daily.
Aber wussten wir nicht eigentlich schon immer, dass wir uns nicht auf fremde Plattformen allein fokussieren und damit abhängig machen sollten? Eigentlich doch ja. Aber hatte die Begeisterung für die pulsierende Social Media Welt vielleicht diesen Gedanken etwas vernebelt?
Aber das ist ein anderes Thema für ein weiteres Gedankenspiel.
Copyright: Photo by Mike Moloney on StockSnap
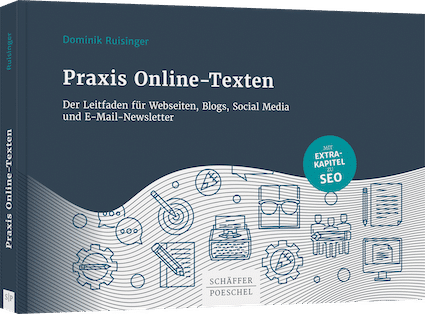
by Dominik Ruisinger | 23.08.2021 | Blog
Am 16. September erscheint erschien mein neues Werk: „Praxis Online-Texten“ ist ein wirklicher Praxis-Leitfaden für das Schreiben für Webseiten, Blogs, E-Mail-Newsletter und Social Media Posts. In diesem Blog-Beitrag publiziere ich die Einleitung zum Buch. Auf diese Weise will ich etwas hinter die Beweggründe für dieses Buch blicken lassen und hoffentlich Lust auf meinen neuen Leitfaden machen.
=> Tipp: Das Buch lässt sich übrigens bereits hier vorbestellen.
Webseiten, Microsites, Landingpages, Online-Magazine, Blogs, E-Mail-Newsletter, Social Media Posts: Alle benötigen Text – mal in leitender, mal in begleitender Funktion. Aber immer darauf ausgerichtet, Besucher, Leserinnen, Abonnenten, Social Media Nutzer möglichst direkt auf den Kern des Inhalts zu lenken. Zeit ist schließlich ein Faktor, der vielen fehlt. Online lesen sie langsamer, scannen häufiger, verstehen schwieriger, sind weniger aufmerksam und schneller abgelenkt. Texte müssen ihnen hier Orientierung bieten. Texte brauchen aber auch selbst Orientierung. Denn nur dann kann sich das Auge auf die relevanten Begriffe, Themen, Inhalte fokussieren.
Doch wie müssen Texte im Web dazu aufgebaut werden, dass sie sofort wahrgenommen werden? Wie müssen Texte formuliert sein, dass sie die Leserinnen begeistern? Wie können Texte Impulse setzen, dass Interessenten vom Text aus direkt auf einen verlinkten Beitrag springen?
„Praxis Online-Texten“ ist ein praxisorientierter und mit Tools, Tipps und Beispielen vollgestopfter Leitfaden für Texter, Redakteurinnen, Autorinnen, Kommunikationsexperten und Medienleute, Content-Spezialisten und Social Media Schreiberlinge. Vor allem ist ein Buch für Menschen, die Freude haben, sich mit dem geschriebenen Wort zu beschäftigen und die ihre Texte für das Web weiter und professionell optimieren wollen.
Ein Praxis-Leitfaden zum Online-Texten
Mein neuer Leitfaden soll ihnen zu verstehen helfen, wie Online-Texte funktionieren, wie Online-Texte gelesen werden, worin sich Online-Texte von Print-Texten unterscheiden und wie Online-Texte aufgebaut sind: vom Titel, über den Teaser bis zum Fließtext. Auch wäre es kein Buch zum Online-Texten, wenn es sich nicht ausführlich mit dem Thema SEO beschäftigen würde. Denn Schreiben für Nutzerinnen aber auch im Sinn von Suchmaschinen gehören heute fast schon zusammen.
Aber stopp: Bitte nicht Online-Texten mit Texten für Suchmaschinen verwechseln. Dies wäre bei weitem zu kurz gedacht. Vereinfacht lässt sich eher sagen: Wenn die Texte den Lesern gefallen, dann werden sie auch Google & Co. zu schätzen wissen. Das werden Sie daran merken, dass viele Tipps aus den „Grundlagen des Online-Textens“ in Kapitel 2 auch beim „SEO-Texten“ in Kapitel 3 wieder auftauchen; und sich beide kombiniert unter den „Bausteinen eines Online-Textes“ in Kapitel 4 wiederfinden, wenn es um die finale Gestaltung eines Beitrages für Online-Medien geht.
Text im Social Media Zeitalter
Texten für Webseiten oder für Online-Magazine ist nicht alles. Online-Texten betrifft weit mehr: Was macht etwa das Schreiben für Blogs aus? Wie müssen Texte für E-Mail-Newsletter formuliert sein? Und wie können Texte im Social Media Bereich ihre Wirkung entfalten? Also bei Facebook, Twitter, LinkedIn oder gar Instagram? Benötigen diese – neben Bildern, Videos und Grafiken – nicht auch eindrucksvolle, leicht lesbare und erklärende Texte? Die unseren Leseweg beeinflussen und unser Verhalten erleichtern? Selbstverständlich.
Ein letzter Aspekt: In den vergangenen Jahren ist das Thema automatisiertes Texten verstärkt aufgeploppt. Schon heute arbeiten viele Redaktionen mit Automatisierungs-Software, um Finanz-, Polizei-, Sport- oder Wetterberichte mehr oder weniger selbstständig schreiben zu lassen. Ist das die Zukunft? Zu dieser Frage habe ich meinen guten Freund und geschätzten Kollegen Andreas Schöning eingeladen. In seinem Gastbeitrag zeigt er an Beispielen auf, was Textgeneratoren schon heute alles können – und was nicht.
Vom Journalismus lernen
Noch etwas wird Ihnen im Buch auffallen, das in der kompakten Toolbox-Serie des Schäffer-Poeschel Verlages erscheint: Viele der Regeln und Prinzipien zum Online-Texten stammen ursprünglich aus dem Journalismus. Auf der einen Seite stellen sich heute immer mehr Unternehmen und Institutionen als Medien auf – Stichwort Content-Marketing, Stichwort Storytelling, Stichwort Newsroom. So lassen sich ur-journalistische Regeln prima auf die Redaktion von Web-Artikeln und sonstigen Online-Medien im Rahmen einer Unternehmenskommunikation übertragen.
Darum lasse ich ins Buch auch Beispiele aus dem Online-Journalismus einfließen, von denen Online-Texterinnen und -Texter für Unternehmen und Institutionen wiederum lernen können. Andererseits ist dieser Mix meiner eigenen Herkunft geschuldet: als gelernter Journalist, geprüfter PR-Berater aber heute aktiver, lernender wie lehrender Online-Texter.
Fazit: Text hat Zukunft
Am Ende werden Sie eines verstehen: Auch wenn das Internet ein stark visuell geprägter Raum ist, sind die Texte ein zentraler Baustein. Und das werden sie weiterhin bleiben.

by Dominik Ruisinger | 03.05.2021 | Blog
Die Diskussion um die verunglückte Kampagne #allesdichtmachen hat eines mal wieder verdeutlicht: Unsere Diskussionskultur ist kaputt. Richtig kaputt. Wir kennen nämlich nur noch schwarz oder weiß, gut oder böse, dafür oder dagegen. Grautöne? Fehlanzeige. Dabei machen diese doch unser Zusammenleben aus, oder?! Ein kleines Plädoyer in den Gedankenspielen für die wunderbare Farbe Grau.
Wer sich die Diskussionen in der vergangenen Woche rund um die misslungene und teils antidemokratisch gefärbte Video-Kampagne #allesdichtmachen näher ansieht oder anhört, dem fällt eines auf: Die Menschen denken hierzulande offenbar ausschließlich in Kategorien: Bist du nicht dafür, dann bist du dagegen. Stimmst du mir nicht zu, gehörst du zu den anderen. Bist du nicht meiner Meinung, liegst du falsch. „In westlichen Gesellschaften macht sich ein gefährlicher Trend bemerkbar: Meinungsfreiheit nur bei denen gut zu finden, die derselben Meinung sind“, beschreibt der Handelsblatt Newsletter diese Haltung ziemlich treffend. Wir bestimmen also, was richtig oder was falsch ist. Und wir bauen um unsere Meinung eine Wagenburg auf und verbannen die Andersdenkenden direkt auf die andere Straßenseite.
Eine kommunikative Spaltung
Nun: Die Diskussionen rund um diese Videoserie sind nur ein weiteres Beispiel dafür, dass es um die hiesige Diskussionskultur wirklich schlecht bestellt ist. Dabei lässt sich diese kommunikative Spaltung – dieses tiefschwarz vs. blütenweiß – schon seit mehreren Jahren beobachten:
- Stichwort Geflüchtete: Wer nicht Geflüchtete „welcome refugees“ heißt, ist ein Nazi. Und umgekehrt.
- Stichwort Coronavirus: Wer nicht den Einschätzungen von Drosten & Co. folgt, ist ein Verschwörungstheoretiker. Und umgekehrt.
- Stichwort gendergerechte Sprache: Wer nicht auf das Gender-Sternchen steht, ist ein Fan des alten weißen Mannes. Und umgekehrt.
Diese Liste ließe sich noch ewig weiter führen. Vielleicht scheinen diese Gegensätze einigen hier übertrieben. Doch werden die Diskussionen genau so geführt – insbesondere in den Sozialen Netzwerken. Übrigens nicht nur in Deutschland. In den USA – Stichwort Trump, Stichwort Black Lives Matter etc. – hat sich die Gesellschaft radikalisiert, was sich dort nicht nur kommunikativ, sondern auch in der Ausgrenzung nur ein bisschen anders denkender Menschen bis hin zu einem fatalen Sturm auf das Kapitol niederschlug. Die Menschen grenzen sich also gegenseitig aus, weil sie die Meinung anderer nicht mehr akzeptieren. Das soll unsere Zukunft sein?
Die Beispiele verdeutlichen, wie stark Sprache und Wörter die Gesellschaft spalten können. Und zwar massiv. Davon profitiert niemand. Ganz im Gegenteil. Wir entfernen uns immer stärker voneinander. Freunde werden zu Gegner, Nachbarn beäugen sich misstrauisch, Freunde werden sprachlos. Und stopp. Es geht nicht darum, alles zuzulassen. Jeder und jede muss eigene Grenzen ziehen – gegenüber antidemokratischem Gedankengut, gegenüber Radikalisierung, gegenüber Menschenverachtung. Jeder muss sich bewusst machen, ab wann es heißt „bis hier hin und nicht weiter“. Aber ist diese Grenze wirklich blütenweiß oder tiefschwarz? Was ist mit den berühmten Zwischentönen, den Grautönen, die für Kommunikation und Diskussion so wichtig sind?
Die wichtige Farbe Grau
Vor rund 25 Jahren gab es eine wundervolle Film-Trilogie des polnischen Regisseurs Krzysztof Kieslowski: Bleu, Blanc, Rouge – also Blau, Weiß, Rot. Heute möchte ich dieser 3-Farben-Trilogie eine weitere Farbe hinzufügen: Das Grau. Nein, sie ist nicht meine Lieblingsfarbe; ich ziehe den blauen Himmel durchaus dem grauen vor. Aber das Grau ist so eminent wichtig. Und so vielfältig. Schließlich verfügt es über so viele Nuancen: Kühl und warm, dunkel und hell, zurückhaltend und exzentrisch mit hunderten von Abstufungen. Vor allem kommen all diese miteinander so gut aus. Denn „Grau kennt keine Grenzen“, wie das Einrichtungshaus Meyerhoff über die Wandfarbe grau schreibt. Genau dies gilt nicht nur für Böden, Wände oder Decken. Sondern ganz insbesondere auch für die Meinungen von Menschen.
Genau diese Farbe müssen wir wieder dringend in uns entdecken. Wir müssen verstärkt die Töne in der Sprache zulassen, die nicht zu unserem Schwarz oder Weiß gehören – ohne aber unseren eigenen Wertekanon zu verlassen. Folglich müssen wir miteinander sprechen, viel stärker anderen zuhören, sie verstehen zu versuchen, also „gemäßigt miteinander diskutieren, einander kritisieren und Eingeständnissen Respekt zollen„. Ansonsten bewegen wir uns nur noch in unserer kleinen Blase.
Sprachlich „abrüsten“ Richtung Diskussionskultur
Grau ist alles andere als trist. Es ist die wichtige Verbindung zwischen den Polen schwarz und weiß. Und genau auf dieser endlosen Grau-Skala zwischen diesen beiden Polen müssen wir uns vorsichtig annähern – und miteinander zu kommunizieren versuchen. Nur dann werden wir es vermeiden, dass sich unsere Gesellschaft noch stärker in zwei Lager aufteilt. Der Schauspieler Ulrich Matthes meint: „Ich kann wirklich nur geradezu flehentlich darum bitten, auf beiden Seiten abzurüsten, miteinander im Gespräch zu bleiben oder überhaupt wieder ins Gespräch zu kommen.“
Dieses Flehen muss jedoch dringend weit über diese eine Video-Aktion hinweggehen. Sie muss unsere gesamte Diskussionskultur erfassen. Ansonsten werden wir uns irgendwann nur noch in unseren klar abgrenzten Blasen und Lagern befinden, die sich feindlich gegenüber stehen. Und davon wird letztendlich niemand profitieren. Diskussionskultur? Fehlanzeige. Schade. Um uns alle.