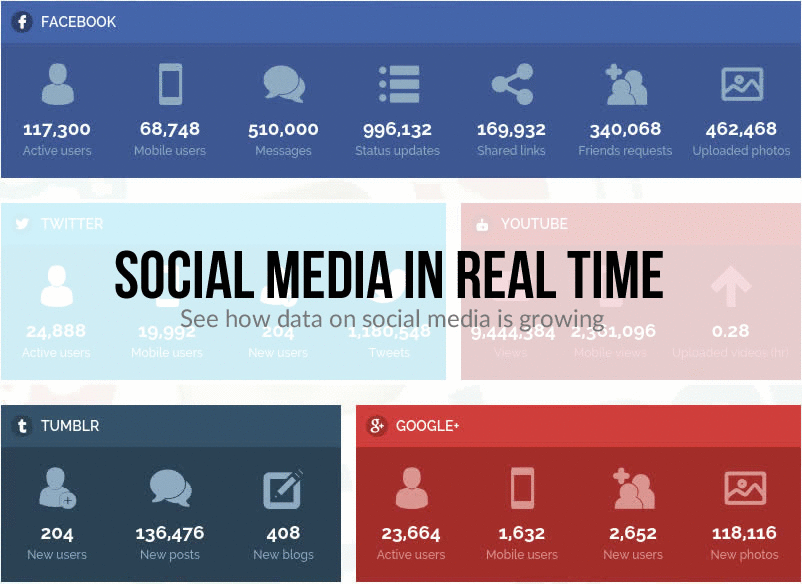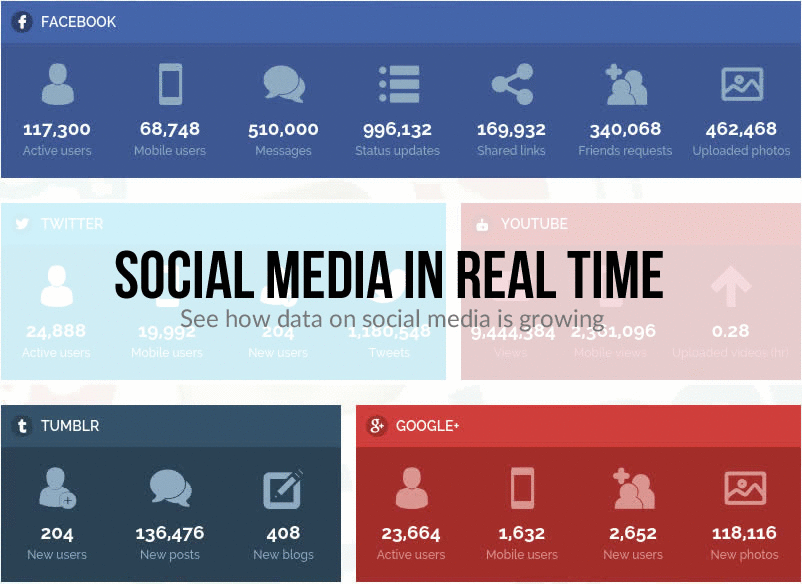by Dominik Ruisinger | 23.08.2016 | Beiträge
Nachdenklich würde ich die Phase nennen, die ich derzeit durchlebe. Sehr nachdenklich. Vieles passiert gerade um mich herum. In meinem direkten privaten Umfeld. Aufregendes und Aufwühlendes zugleich. Die Digitalisierung mit ihrer Vielfalt an Möglichkeiten und Instrumenten spielt ihre Rolle. Aber eher als Verstärker und Beschleuniger. Für eine überforderte und sich selbst überfordernde Generation. Doch um was geht es konkret? Oder anders gefragt: Woran krankt die Gruppe?
Freunde, die mit einem Schlaganfall zusammenbrechen, die sich selbst in psychatrische Kliniken einweisen, die ihren hoch bezahlten Stress-Job gegen einen qualitativ schlichteren einlösen, die vor dem Hintergrund hoch anspruchsvoller Aufgaben nicht mehr schlafen, die sich von Depressionen geplagt aus dem Fenster stürzen, die sich angstvoll vor der nächsten E-Mail fürchten, die ihren Psychiater als ständigen Begleiter benötigen, um wieder den eigenen Weg zu finden oder die eines Tages ausbrechen, aufbrechen und aussteigen.
Alles real. Alles Personen zwischen 40 und 50 Jahren. Alles Angestellte, Bereichsleiter, Geschäftsführer. Meist mit Verantwortung für sich und für andere. Mit Anforderungen, vor denen sie plötzlich kapitulieren. Weil sie sich überfordert fühlen. Weil sie am Rande ihrer Kräfte sind. Weil sie nicht mehr können. Weil sie immer weniger weiterwissen. Dann ist der Moment da, der mit einem Schlag vieles verändert: Das eigene Leben, die Familie, die Umgebung, die Existenz. Ja, es läuft etwas falsch in unseren Leben. Zumindest bei vielen. So erlebe ich derzeit das Umfeld meines eigenen Lebens.
Die USA als „Vorbild“
Viele dieser Brüche sind gekettet an eine veränderte Arbeitswelt. Die Zeiten, in denen man noch einen Beruf ergriff und ihn dann sein Leben lang ausführte, ja, die Zeiten sind vorbei. Und dies insbesondere seit meiner Generation. Also von Menschen, die heute grob zwischen 40 und 50 Jahren alt sind. Während sich noch die große Mehrheit unserer Eltern, Großeltern, Onkel und Tanten in ihrem Berufsleben höchstens einmal von ihrem Job trennte – oder aber ungewollt getrennt wurde –, gelten solche Menschen heutzutage als aussterbende Spezies. Für alle anderen gilt: Gestern dort, heute hier, morgen da. Zu Lasten oft von sich selbst und ihrem direkten Umfeld; und übrigens damit auch ihrer Arbeitgeber. Und mit einer zu tragenden Last ausgestattet, deren Gewicht sie sich erst spät bewusst werden. Und häufig deutlich zu spät.
Ich kann mich noch gut erinnern, dass wir vor rund zwei Jahrzehnten mit etwas Verwunderung – in die sich Bewunderung wie Verwirrung mischte – auf den US-amerikanischen Arbeitsmarkt blickten. Mitarbeiter wechselten dort äußerst häufig ihren Arbeitsplatz, gewollt wie ungewollt. Alle zwei bis drei Jahre. „Hire and Fire“ nannte sich das. Auf der einen Seite trug dazu die schwache arbeitsrechtliche Arbeitnehmer-Position bei, die von ihren Arbeitgebern ohne Angabe von Gründen leicht und schnell gefeuert werden konnten. Auf der anderen Seite galt gerade für eine jüngere, gut ausgebildete, nachdrängende Generation das längere Verharren auf einem Job als Zeichen, dass man nicht nach oben wollte, dass man keinen Ehrgeiz hatte, dass man nicht an sich selbst glaubte. Das Ergebnis war ein „Hire and Fire“ – aber intern wie extern provoziert.
Wenn Anforderungen an der Kraft nagen
Eine ähnliche Entwicklung lässt sich immer stärker bei uns in Deutschland beobachten. Und auch hier mit internen wie externen Beweggründen verbunden. Viele jüngere Menschen nehmen das dauerhafte Wechselspiel als ihren persönlichen Change- und Entwicklungsprozess an. Ein befreundeter Agenturchef bezeichnet sein Unternehmen sogar bereits als „eine pure Stufe auf einer Karriereleiter“. Viele jüngere Arbeitnehmer würden kommen, ausgebildet werden, eingearbeitet werden und bald schon wieder nach etwas Neuem streben. Ganz anders das Bild bei vielen älteren Arbeitnehmern, auch bei Selbstständigen. Sie fühlen sich überfordert, mit den immer schnelleren Veränderungen umzugehen.
Ich kenne heute viele, bei denen der Satz „Wie soll ich das heute noch alles schaffen“ zu einem täglichen zentralen Leitspruch geworden ist. Als eine Art Hilferuf, weil sie vielen Anforderungen immer schwieriger und mühsamer genügen können. Nur, was nagt und kratzt konkret an ihren Kräften?
- Das Alter: Dass mit 40 bis 50 Jahren die Anstrengungen im Berufsalltag nicht mehr ganz so spurlos weggesteckt werden wie mit Mitte 20, das ist verständlich und nachvollziehbar. Die Jahre auf dem Buckel haben Spuren hinterlassen, Energiereserven sind stark ausgeschöpft. Die Wahrnehmungs- und Verarbeitungsfähigkeit haben nicht mehr die vor Kraft strotzende Intensität wie notwendige Leichtigkeit, die sie einst hatten. Und das ist zu spüren. Gerade bei für den Geist und für die Seele anspruchsvollen Aufgaben.
- Die Konkurrenz: (Fast) Jeder Mitarbeiter ist ersetzbar. Von Maschinen oder von Menschen. Und vor allem dann ersetzbar, wenn die andere Person jünger, fitter und gut qualifiziert ist. Plötzlich merkt der Arbeitnehmer, der Selbstständige, der Freelancer, dass der Begriff „Erfahrung“ doch nicht ein so hohes Gut ist, als was er oftmals beschrieben und gepriesen wird. Wenn die Konkurrenz hinter dem Arbeitsstuhl drückt, so trägt es bei den meisten nicht gerade zu einer Beruhigung des eigenen Nervenkostüms bei.
- Die Erreichbarkeit: Arbeitnehmer sind heute für ihre Jobs immer da. Selbst in den Ferien. Laut einer Studie sind 60 Prozent der Führungskräfte auch im Urlaub erreichbar. Das ist irgendwie auch nachvollziehbar. Schließlich wollen sie sicher gehen, dass die Geschäfte auch während ihrer Abwesenheit weiterhin gut laufen. Nur gilt dies auch für sonstige Arbeitnehmer. Einer Umfrage des Branchenverbandes Bitkom zu Folge sind 67 Prozent der Arbeitnehmer im Urlaub für ihren Arbeitgeber zu erreichen. Dabei stehen laut Bundesurlaubsgesetz – was es für Gesetze gibt! – jedem Arbeitnehmer mindestens vier Wochen arbeitsfreie Zeit zu, um sich zu erholen. Schon mit Anrufen wird der Urlaubszweck gestört. Nur wer beschwert sich? Niemand. Die Überall-und-Immer-Erreichbarkeit ist für viele fast schon normal. Hinzu kommt: Jeder dritte Beschäftigte ist sich unsicher, ob Kollegen oder Vorgesetzte von ihm erwarten, dass er in der Freizeit auf ihre Kontaktversuche reagiert. Also nimmt er doch lieber die Erreichbarkeit gleich in Kauf.
- Das Ende des Privaten: Die dauernde Erreichbarkeit ist eng mit einem weiteren Phänomen zu sehen, unter dem unsere Generation leidet – ob bewusst oder unbewusst. Die immer stärkere Vermischung von Privatem und Beruflichem. Die Zeiten, in denen die schönsten Wochen des Jahres dem völligen Abschalten gewidmet sind, fernab von Aufgaben, Verantwortungsbereichen und Problemlösungen, diese sind vorbei. Nur: Wenn es keine Trennung mehr gibt, wird plötzlich alles beruflich und damit Job relevant. Und damit stets involvierend. Völliges Abschalten? Zumindest schwierig.
- Der Information-Overload: Eine immer stärker digitalisierte Gesellschaft transportiert bei vielen Menschen auch Unsicherheit. Sie haben das Gefühl, nicht mehr mitzukommen. Sie fühlen sich überfordert, angesichts einer kontinuierlich steigenden Anzahl an Informationskanälen, Instrumenten, Quellen, Medien. Sie fragen sich: Wie soll ich diesen Content-Shock noch ordnen und für mich bewerten, um noch „mitzukommen“? Auch bei dem Punkt stellt sich eine Art von Frustration ein, verbunden mit der Angst vor dem Jobverlust und dem langsam aufkommenden Gefühl, vielleicht eines Tages nicht mehr gebraucht zu werden.
- Die menschliche Ferne: Dass der Studienort nicht mehr dem Ort der Geburt oder der Schule entspricht, daran haben wir uns gewöhnt. Dass die Arbeitsorte sich den Lebensorten immer stärker entkoppeln, setzt noch einen drauf. Mit hohen Auswirkungen auf das Leben. Denn diese Trennung stellt enorme Herausforderungen für Beziehungen und für Familien. Schon heute werden laut Statistik 14 Prozent aller Partnerschaften in einer Fernbeziehung geführt, in denen einer der Partner pendelt und sich beide nur am Wochenende sehen. Der häufigste Grund für diese Form ist der Job. WhatsApp, Skype, dem Facebook Messenger oder FaceTime heißen die wichtigsten Beziehungspflege-Instrumente. Aber wo ist die Person, die einen auch gerade in schwierigen Momenten stützt? Aus den dunklen Gedanken reißt? Die ganz nahe ist, wenn das Schwarze vor Augen immer pechschwärzer wird und keine Lichtstrahlen mehr durchlässt? Die hält, bewahrt, beschützt, aufrüttelt, hilft? Und zwar vor Ort?
Wir, die Kräfte-Nagetiere
Der Umwelt die Schuld für die Last zu geben, die zu heben und zu tragen ist, das wäre zu einfach. Schuld hat an dem „Phänomen“ niemand, höchstens man selbst. Denn wir, die Generation, sind es nämlich auch selbst, die der Situation nichts entgegen setzen, sondern sie aktiv fördern.
- Der dauernde Ehrgeiz: Auch die 40plus-Generation fühlt sich weiterhin ganz jung. Und sie tut alles dafür, nicht alt zu sein. Der Boom von Fitness-Center-Besuchern und Fitness-App-Downloads auch bei 40- bis 50-Jährigen ist ein gutes Zeichen dafür. Auch beruflich wollen sie weiterhin alles genauso so weitermachen wie bisher. Sie sind ja noch jung. Sie machen sich damit selbst einen gehörigen Druck, dem sie oft kaum standhalten können. Denn sie merken nicht – oder wollen es zumindest nicht wahrnehmen –, dass sich ihre Konditionen verändert haben. Und zwar in erster Linie die Konditionen ihres eigenen Körpers.
- Der finanzielle Druck: Nach den Phasen der Schule und der Universität oder Lehre haben viele Menschen in ihren eigenen späten 30er-Lebensjahren eine Familie gegründet – oder auf jeden Fall sich ein Zuhause geschaffen. Viele dieser Zukunftspläne wurden auf Kredit finanziert: Eigentumswohnungen, Eigenheime, Familienkutsche, Ferienhäuser. Spätestens in den unsicheren Phasen eines Jobs stellt sich bei Festangestellten (Selbstständige kennen solche Faktoren der Unsicherheit deutlich näher) natürlich sofort die Frage, wie der belastende Kredit noch zu bedienen ist. Bricht an der Stelle plötzlich eine Zukunft wieder zusammen, die sie sich über die Jahre mühsam aufgebaut haben? Eine Zukunft, die auch die eigene Familie betrifft? Gerade solche Ängste können in hohem Maße zu Verzweiflung, zur Unruhe, zu nicht geplanten Taten führen, die nicht nur das eigene Leben zu zerreißen bedrohen.
- Die eigenen Erwartungen: Der finanzielle Druck ist wiederum oft verbunden mit der Erwartung an die eigene, natürlich perfekte Familie. Gerade Männer erwarten von sich selbst, dass sie ihr alles bieten können. Als Bild nach innen wie nach außen. Hinzu kommt: Viele mir wohl bekannte Menschen haben das Ziel in sich verinnerlicht, auf jeden Fall die gesellschaftliche Stellung ihrer Eltern zu erreichen bzw. sie sogar zu übertreffen. Sie bauen sich damit – auch innerhalb der Familie – einen ungehörigen Druck auf, dem sie in guten Zeiten genügen können, von dem sie in schlechteren Zeiten jedoch schnell erdrückt werden. Aus eigenem Mit-Verschulden.
Out-of-the-Box-Solution? Fehlanzeige
Wenn ich mir solche Verhaltensmuster vor Augen führe – und meine Beschreibung ist mit Sicherheit nur ein kleiner Auszug davon –, dann werde ich nachdenklich. Nachdenklich gegenüber meiner eigenen Generation. Nachdenklich aber auch gegenüber der Generation, die folgt. Denn warum sollte sich diese beschleunigte Entwicklung plötzlich entschleunigen? Solange wir gewollt oder ungewollt, intern wie extern solch einen Druck auf uns ausüben? Finden wir dazu noch rechtzeitig die Bremse? Oder bezeichnen wir uns bald alle als Stadtneurotiker? Mit einem Psychologen oder Psychoanalytiker als ständigen Begleiter? Oder heißt die Lösung „Aussteiger“, was die hohe Beliebtheit solcher TV-Sendungen erklären könnte? Also der Traum von einem anderen Leben, in dem natürlich alles schöner, einfacher, lebensfroher sein wird …
Wie könnte eine Lösung in diesem Dilemma aussehen? Gibt es sie überhaupt? Wahrscheinlich nicht. Zumindest nicht als allgemein gültige „Out-of-the-Box-Solution“. Sicher ist nur: Diese meine Generation muss sich viel bewusster machen, dass ihre Kräfte begrenzt sind, dass es kein ewiges „Weiter-so“ geben kann, wenn sie sich nicht in einer Periode vermehrt auftretender Katastrophen wiederfinden will. Mäßigung, Entspannung, Herunterkommen, Durchatmen, Loslassen, auch Slow Media. Stattdessen müssten so die Begriffe eines Lösungsansatzes heißen. Eigentlich.
Doch wer lässt los, solange er noch nicht gefallen ist und an das eigene „Weiter-so“ noch glaubt? Kaum jemand. Was verständlich wie traurig zugleich ist. Ein Freund erzählte mir vor kurzem: „Mein Vater ist mit gut 60 Jahren aus dem Job ausgestiegen. Dem geht es heute noch ganz gut. Wie soll ich es denn noch bis zu meiner Rente aushalten? Bis dahin bin ich doch ein Wrack!“
by Dominik Ruisinger | 14.08.2016 | Beiträge
Instagram hat seinen eigenen Algorithmus installiert. Für das Unternehmen selbst bzw. Papa Facebook im Hintergrund recht logisch. Doch für viele bisherige Instagram-Fans eher ernüchternd. Weil er Bekanntes betont und Entdeckungen verbirgt. Was das heißt?
Seit einigen Wochen bekommt jeder Instagram-Nutzer den neuen Algorithmus zu spüren. Und zwar deutlich. Denn ähnlich wie bei Facebook regelt der Instagram Algorithmus, welche Bilder und Videos der Nutzer in welcher Reihenfolge zu sehen bekommt. Auch wenn im Unterschied zu Papa Facebook keine Beiträge verborgen, sondern nur die Reihenfolge ihrer Sichtbarkeit bestimmt wird, hat dies Folgen. Für die Nutzer. Und zwar kräftige. Und nicht immer nur positive.
Wenn ich mir meinen eigenen Instagram-Stream ansehe, so sind seit einigen Tagen praktisch nur noch Bilder sichtbar von
- Personen, mit denen ich auch auf Facebook regelmäßig interagiere … hallo Instagram-Facebook-Verbindung!
- Accounts, mit denen ich bereits in der Vergangenheit intensiv interagiert habe – ob per Likes oder per Comments;
- Accounts, die in meiner regionalen Nähe Bilder posten.
Am häufigsten sehe ich aber Bilder und Videos von Accounts, auf die alle drei Faktoren zutreffen. Und davon aber maßlos viel Bilder. Wenn solche Accounts hintereinander oder innerhalb eines kurzen Zeitraums beispielsweise gleich fünf Bilder publizieren, bekomme ich (fast) alle zu sehen. Ein Resultat: Für die letzten 100 Bilder in meiner Timeline waren genau 23 Personen verantwortlich. Ist das nicht irgendwie schade?
Wo ist meine Inspirationsquelle?
Der Algorithmus ist für mich persönlich – ehrlich gesagt – ziemlicher Schrott. Wo ist denn das Instagram als Inspirationsquelle geblieben? Nein, das ist jetzt kein #mimimi-Artikel. Nur: Für mich hat der Reiz von Instagram immer das Überraschende, das Nicht-Planbare, die plötzlichen visuellen Emotionen ausgemacht. Dass man Accounts z.B. von Künstlern oder Fotografen bewusst abonniert hat, weil sie einen mit ihren Bildern und Videos überrascht, inspiriert, ein Lächeln auf die Lippen gezaubert haben.
Ich hatte mich an ihren Werken erfreut – ohne mit ihnen direkt zu interagieren. Und das ist das Problem, mein Problem: Keine Interaktion, kein Like, kein Kommentar bedeutet jetzt keine Sichtbarkeit mehr. Und schon sind sie – mit dem neuen Algorithmus – aus meinem Blickfeld verschwunden, auch wenn sie noch so viel und schön posten.
Instagram sitzt damit – aus meiner persönlichen Sicht – in einer ziemlichen Inspirationsfalle. Auf der einen Seite ist der Schritt aus Unternehmenssicht vielleicht ein wenig nachvollziehbar, wenn man die Interaktion mit Bekanntem fördern will. Nur was macht man auf der anderen Seite mit Menschen wie mir, die gucken aber oftmals nicht interagieren? Die die Vielfalt von fremden Instagram-Nutzern, von internationalen Foto-Künstlern als das Besondere erkannt hatten? Die spielen für Instagram anscheinend keine Rolle mehr. So wie ich.
Listen machen glücklich!
Dabei gäbe es eigentlich eine recht einfache Lösung: Und die heißt Listen. Übrigens genau so wie bei Facebook (auch wenn sie noch immer wenige Nutzer kennen und intensiv nutzen). Listen würden einiges erleichtern. Eine Liste für Freunde, für Kollegen, für spannende Firmen, für Inspirationen, für besondere Accounts etc. Und alle wären glücklich: Die Nutzer, weil sie sich wieder inspirieren lassen können oder zu interagieren, und auch Instagram übrigens, da die gezielte Listen-Kommunikation wahrscheinlich eine deutlich höhere Interaktionsrate mit sich bringen würde als das bisherige, meist etwas planlose Scrollen. Oder ist das so schwer umzusetzen?
Noch habe ich Hoffnungen, dass sich hier etwas tut. Und dies möglichst bald. Ansonsten bin ich weg. Denn die vielen Bilder meiner Freunde neben Facebook auch noch bei Instagram anzusehen, das brauche ich wirklich nicht. Also tu was, Instagram!
by Dominik Ruisinger | 09.08.2016 | Beiträge
Wer das erste Mal durch Japan reist, dem fallen nicht nur die Freundlichkeit der Menschen, die Pünktlichkeit der Verkehrsmittel, die Lautstärke der Video-Außenwerbung, das schrille Funkeln der Schilder, das Lärmen der Spielsalons oder die Höhe der Gebäude im Wechsel mit altehrwürdigen Schreinen und stillen Gärten auf, um nur wenige Beispiele für dieses Land der Kontraste zu nennen. Schließlich ist die Fusion aus jahrhundertealter Tradition und nach vorne sprudelnder Moderne, an bedächtiger Würde und grenzenloser Schrille an kaum einem anderen Ort der Welt so intensiv zu beobachten wie im Land der aufgehenden Sonne.
Unübersehbar – gerade für Medien- und Kommunikationsleute – sind die vielen sonderbaren Schilder, die Bewohner wie Touristen hinweisen, warnen, anziehen sollen. Das Besondere: Es sind keine normalen Schilder mit normalen textlichen Beschriftungen und den normalen passenden Bildern – und dazu noch im normalen Corporate Design der jeweiligen Marke.
Symbole und Zeichen statt Texte
Japaner pflegen vielmehr eine eigene Schilder-Sprache, die auf Illustrationen, Zeichen und Symbole setzt, die mit Tieren und Fantasiefiguren spielt, die aus Zeichnungen und figurativen Elementen besteht. Bei Hinweisen auf Spielsalons oder eine Bar lässt sich die Sprache noch nachvollziehen. Nur reicht diese Kunstform der Kommunikation deutlich weiter: Baustelle betreten nicht erlaubt, Willkommen in einem Kaufhaus, Werbung für eine Karaoke-Bar oder den lokalen Fußball-Verein, Warnung vor der Erwärmung der Erdoberfläche und vieles mehr: Derartige Aufforderungen werden nicht in Text- sondern in Symbolform dargestellt, wie die folgenden integrierten Beispiele verdeutlichen. (Lesetipp: Mehr zur japanischen Werbekultur lässt sich auch in dieser ausführlichen Seminar-Arbeit nachlesen)
Oft habe ich mich bei meiner Reise gefragt, wo solch eine Sprache der Illustration, der Zeichen und Symbole ihre Ursache hat. Angesichts ihrer Übertragbarkeit und Internationalität könnte man denken, dass dies ein Gefallen der Japaner an ihre auswärtigen und meist des Japanischen nicht geübten Besucher ist. Nur dies wäre von ihrer Gastfreundschaft wohl zuviel verlangt. Oder ist es die generelle Verbundenheit mit der Comic-Sprache, die sich in der Manga-Kultur niederschlägt, die einen die ganze Reise über begleitet und welche die Süddeutsche zu Recht als „unterschätzte Kunstform“ bezeichnet? Auch dies überzeugt mich als Erklärung nicht wirklich. Aber woher kommt sie dann, die visuelle Sprache? Ehrlich gesagt, ich als Nicht-Japanologe weiß es nicht.
Einsatz als Corporate Language?
Mir als Kommunikations- und Marketingmensch stellt sich dafür eine ganz andere Frage: Ließe sich solch eine – vereinfachende – spielerische und illustrative Symbolsprache nicht als Corporate Language für eine Marke nutzen? Bis auf Red Bull mit Einschränkungen ist mir kaum eine Marke bekannt – und damit meine ich keine abgetrennte Kampagne -, die ihre Corporate Language vollständig auf Basis solcher Symbole aufgebaut und an diesen ausgerichtet hat. Selbst eine Marke wie Red Bull hat sicherlich mit der „Red Bull verleiht Flügel“-Kampagne einen visuell geprägten Sprache geschaffen, sie dann aber auf das pure Motto auch beschränkt.
Je häufiger ich mir die japanische Symbol-Sprache jedoch ansehe und die vielen Beispiele bewundere, desto interessanter wirkt auf mich der Ansatz. Schließlich ließe sich auf die Art eine universelle Sprache entwickeln, die durch ihre stark visuell geprägten Elemente und ihre illustrative Kraft auf der einen Seite schnell und einfach wahrnehmbar wäre, andererseits ein unverwechselbares Bild einer Marke nach innen wie nach außen zeichnen könnte.
Ohne Konsequenz kein Erfolg
Nur: Warum macht dies bei uns kaum eine Marke? Gibt es dazu spezielle Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen? Sind wir Deutschen für eine solche Symbol-Sprache nicht bereit? Und für welche Marken mit ihren Angeboten und Services würde sich dies am ehesten anbieten? Jede müsste sich bewusst sein, dass ein Erfolg – siehe Beispiel von Red Bull – nur dann eintreten könnte, wenn solch ein Weg sehr konsequent und vor allem langfristig geführt wird. Denn nur dann kann es irgendwann auch für Markenversprechen und -aussagen gelten, dass Illustrationen wirklich „mehr als 1.000 Worte sagen“.

by Dominik Ruisinger | 25.07.2016 | Beiträge
In den letzten Monaten sind immer wieder zwei Entwicklungen zu beobachten, die aufeinander prallen und doch die zwei Hälften eines neuen großen Ganzen ergeben: Die verstärkte passive Nutzung der Sozialen Medien und das immer mächtigere Aufkommen der Messenger-Kommunikation.
Nicht nur in Deutschland sondern auch weltweit werden Soziale Netzwerke wie Facebook & Co. verstärkt passiv genutzt. Immer mehr Nutzer fokussieren sich ausschließlich auf das Beobachten, das Lesen, das Verfolgen, maximal das Kommentieren. Dies zeigt sich nicht nur in mehreren nationalen wie internationalen Studien wie beispielsweise dem Social Media-Atlas von Faktenkontor (siehe Abb.). Die anfangs schleichende und heute immer deutlich sichtbarere Veränderung im Verhalten spiegelt sich auch in allen meinen Coachings und Seminaren in den vergangenen 12 Monaten wieder. Und die meisten hier werden dies ebenfalls an ihrem eigenen Verhalten oder dem ihrer Familienangehörigen, Freunde, Partner, Kollegen beobachten können.

Mehr Statistiken finden Sie bei Statista
Dazu kommt: Je jünger die Menschen sind, desto radikaler und eindeutiger ist der Schwenk zu erkennen. Viele von ihnen haben beispielsweise Facebook nicht verlassen, wie immer wieder gerne geschrieben wird; sie haben sich vielmehr in die Passivität zurückgezogen. Ganz vereinfacht gesagt heißt es für sie und für immer mehr Menschen: Posten und erzählen ist „out“, lesen und angucken bleibt „in“. Solch eine Aussage gilt jedoch nur für den öffentlichen Raum.
Das Begehren nach privater Kommunikation
Denn auf der anderen Seite sind die Messenger-Dienste weiter massiv am wachsen. Ihre Erfolgsreise nach oben scheint kein Ende und keine Grenzen zu finden. Hunderte Millionen bis Milliarden Nutzer haben WhatsApp, Facebook Messenger, WeChat, Line, Wire, Threema, Telegram oder auch Snapchat installiert, um die Chat-Kanäle vor allem für ihre private Kommunikation zu nutzen. Tendenz weiter wachsend.
„Die Zeiten sind demnach vorbei, in denen User in den Social Media alles von sich preisgeben. Ungeniert ihre Bilder, Anekdoten und Geschichten posten oder sich öffentlich mit anderen Nutzern konstruktiv austauschen. Interessiert doch sowieso keine Sau“, schreibt Stefan Schütz auf Zielbar. Plötzlich steht das Begehren nach einer deutlich privateren, persönlicheren, individuelleren, ja intimerer Kommunikation im Vordergrund. Und genau dafür bieten die vielfältigen Messenger das perfekte Werkzeug. Gut lässt sich damit der Run auf WhatsApp & Co. erklären, warum allein die Facebook-Tochter mit rund 40 Millionen Nutzer in Deutschland eine derart hohe Beliebtheit genießt, warum selbst Datenschutzbedenken bei der täglichen Nutzung kaum eine Rolle spielen und warum sich die Messenger gleichzeitig per Update den Nutzerwünschen ständig neu anzupassen und gerecht zu werden versuchen. Schließlich schläft die Konkurrenz auf dem immer härteren Markt nicht.
Von der Many-to-Many zu One-to-One
Beide nur scheinbar gegensätzliche Entwicklungen lassen sich unter einen gemeinsamen Nenner stellen: Die Menschen verlagern ihre Kommunikation aus der Öffentlichkeit ins Private. Oder wie es in der Kommunikationssprache heißt: Von einer Many-to-Many- zu einer One-to-One-Kommunikation oder maximal einer One-to-Many-Kommunikation. Um diese drei Kommunikationswege kurz zu klären: „One-to-One “ beschreibt den Informationsaustausch zweier Individuen wie beim E-Mail-Verkehr oder bei einem Messenger, wie in Gesprächen, in einer Beratung oder beim Kundenservice. „One-to-Many“ bezeichnet die Kommunikation von einer Person mit mehreren wie beim E-Mail-Newsletter oder bei den Broadcast-Listen von WhatsApp. Die komplexeste Form ist die „Many-to-Many-Kommunikation“, bei der gerade in Netzwerken viele mit vielen kommunizieren.
Über viele Jahre hinweg war eigentlich „Many-to-Many“ der Inbegriff insbesondere für das Social Web. Gerade in den Sozialen Netzwerken tauschten sich viele mit vielen anderen zu Themen oder beteiligten sich an Diskussionen. Die Menschen hatten festgestellt, wie es Professor Peter Kruse ist seinem legendären Kurzvortrag vor der Enquête-Kommission des Deutschen Bundestages sagte, dass es auch spannend sei, sich im Netzwerk darzustellen und Spuren zu hinterlassen. Und dies öffentlich. Doch was passiert nun?
Snaps sind die privaten Chats
Die Menschen beginnen gerade, ihre Kommunikationsaktivitäten immer stärker von der öffentlichen Kommunikation – was insbesondere den Branchenriesen Facebook betrifft – in geschlossene, private Bereiche zu verschieben, wo sie sich mit einzelnen Freunden individuell oder maximal innerhalb von Gruppen mit ausgewählten Mitgliedern und damit Gleichgesinnten austauschen. Plötzlich dominiert damit die persönliche Kommunikation, das „One-to-One“ im Social Web – abgesehen von den weiterhin beliebten Gruppen. Kehren wir damit – zumindest ein bisschen – zu den Anfängen der Kommunikation zurück? Und wie müssen die Organisationen darauf reagieren?
Auf der einen Seite hat dies Facebook selbst erkannt und will den Beiträgen der eigenen Freunde wieder eine größere Sichtbarkeit geben – zu Lasten der Unternehmen. Doch wird dies Nutzer dazu bewegen, sich mit ihren Inhalten wieder verstärkt der Öffentlichkeit zuzuwenden? Ich habe meine Zweifel.
Auf der anderen Seite setzen sich immer mehr Unternehmen, Institutionen, Medien mit WhatsApp-Services und Messenger-Chatbots auseinander, um über den Weg die Nutzer in ihrer neuen privaten Umgebung zu erreichen. Doch Vorsicht: Bis auf die Teilnehmer der Social Media Bubble nutzt die allergrößte Mehrheit die Messenger rein im privaten Umfeld. Beispiel Snapchat: Wer mit jüngeren Nutzern spricht, dem fällt eines auf: Die Snapchat Stories oder der Discover Bereich spielen für sie kaum eine Rolle. Stattdessen versenden sie hunderte, manchmal sogar tausende Snaps pro Tag an ihre Freunde – also wieder pures One-to-One. Für sie sind die kurzen Bilder die Stories in ihrem ganz privaten Chat. Nur was passiert, wenn sich jetzt immer mehr Unternehmen dazwischen schalten wollen?
Ressourcen, Ressourcen, Ressourcen
Ich habe den Eindruck, dass sich Organisation künftig darauf konzentrieren müssen, die Bedürfnisse ihrer Nutzer noch stärker kennen zu lernen – Stichwort lebenslange Stakeholder-Analyse. Sie müssen akzeptieren, dass die Nutzer sie bei ihren Gesprächen nicht dabei haben wollen. Wenn sie sich dennoch einmischen und ungeschickt dazwischen drängen, ziehen sich die Nutzer zurück – zu einem anderen der täglich neu entstehenden Kommunikationskanäle. Parallel müssen sie viel genauer und schneller als bisher erkennen, an welchen Stellen sie auf deren individuelle Bedürfnisse, auf deren dringende Fragen, auf deren relevante Wünsche mit wirklichem Mehrwert reagieren können.
Dies stellt sie wiederum vor zwei eng verbundene Herausforderungen: Um Fragen und Bedürfnisse erkennen und beantworten zu können, werden sie sich immer mehr von größeren Zielgruppen verabschieden müssen, sondern sich stattdessen auf kleinste Micro-Zielgruppen bis hin zum individuellen Dialog fokussieren. Ob sie diese dann per Service-Bot, per Messenger-Chat, per WhatsApp-Broadcast-Liste, per Siri oder per traditionellem E-Mailing bedienen, spielt eine weitaus geringere Bedeutung.
Viel wichtiger ist bei der Entwicklung die zweite Herausforderung: Unternehmen und Institutionen werden massiv an Ressourcen zulegen müssen, um individuelle Bedürfnisse zu erkennen, zu analysieren und diese dann auch im Dialog und dazu kontinuierlich befriedigen zu können. Ansonsten werden sie nicht mehr wahrgenommen – ob als One-to-One-, als One-to-Many- oder als Many-to-Many-Partner.
***** VORMERKEN: Neues Strategie-Buch *****
Dominik Ruisinger: Die digitale Kommunikationsstrategie. Praxis-Leitfaden für Unternehmen; mit Case-Studies und Experten-Beiträgen; für eine Kommunikation in digitalen Zeiten. ab 11/2016, Schäffer-Poeschel Verlag, hier vorbestellen.
![Mein Wunschzettel an Dich, liebe Deutsche Bahn]()
by Dominik Ruisinger | 20.06.2016 | Beiträge
Meine liebe Deutsche Bahn,
ich mag dich wirklich. Und das ist auch genau so und ernst gemeint. Denn du gibst dir Mühe, viel Mühe. An vielen Stellen. Und hast auch mir in der Vergangenheit oft geholfen. Gerade wenn du selbst Fehler gemacht hast. Nur: Nach rund zwei Wochen Japan hätte ich doch einige ganz konkrete, konstruktive Vorschläge, wie du deinen Freund, also mich, und all deine anderen Freunde, die guten Bekannten, aber auch deine Gegner – die du immer unter dem Begriff „Kunden“ subsumierst – *(Kleiner Tipp: Hast du schon mal das Cluetrain Manifest gelesen? Ist lehrreicher als viele noch so gut gemeinte Corporate Language Lehrfilme) – noch zufriedener stellen könntest. Um mich auf künftige Veränderungen bei dir besser einstellen zu können, wäre es ganz super, wenn du mitteilen könntest, ob, bis wann und wenn nicht warum du welche Vorschläge annehmen und umsetzen wirst. Du willst unsere Freundschaft doch pflegen, oder?
1. Freundlichkeit.
Der Kunde ist in Japan nicht König. Er ist Gott. Und das wird gezeigt – durch eine extrem hohe Personalpräsenz und das höchste Maß an Freundlichkeit. Kaum verweilt man eine Sekunde unentschlossen am Bahnhof, hat man schon einen Helfer an seiner Seite, selbst wenn sich dessen Englisch-Kenntnisse teils auf ein freundliches Lächeln beschränken. Gerade diese Präsenz verbunden mit einem höchsten Maß an Hilfsbereitschaft würde ich mir von dir erwünschen, wenn ich das nächste Mal etwas verloren auf dem Bahngleis herumstehe – bei einer deiner berühmt-berüchtigten Wagenänderungen oder einer Verspätung, beides übrigens völlig undenkbar hier in Japan.
2. Pünktlichkeit.

Übersichtlicher Wagenanzeiger in Tokyo, Japan
Ich hatte schon im Vorfeld einiges über die Pünktlichkeit von Japans Verkehrsmitteln – ob Bahn oder Subway – gehört. Das Vorort-Ergebnis hat diesen Eindruck weiter verstärkt. In den knapp zwei Wochen meines Aufenthaltes habe ich keinen einzigen Zug mit Verspätung erlebt. So ist es nicht überraschend, dass es den bekannten Spruch „Wir möchten uns für die Verspätung und die damit verbundenen Unannehmlichkeiten entschuldigen“ hier nicht zum Wortschatz zählt.
Warum mir das so wichtig ist? Bei meiner letzten geschäftlichen Reise kurz vor meiner Japan-Reise kostete mich eine deiner Weichenumstellungen mal wieder ein Meeting samt Dinner. Was lernen wir also daraus: Pünktlichkeit = Verlässlichkeit = zufriedene Kunden = stärkere Multiplikatoren = mehr Kunden = höhere Umsätze. Das rechnet sich also doch, oder? Vor allem liefert dies einen deutlich höheren und dazu relevanten ROI im Vergleich beispielsweise zu all deinen Social Media Aktivitäten – auch wenn solche Vergleiche natürlich hinken.
3. Organisation.

Japanischer Bahnhof mit einfacher Orientierung beim Einstieg
Eine veränderte Wagen-Reihenfolge ist für viele eurer Kunden ein großes Ärgernis. Auch für mich. Sorgt sie auf Bahnsteigen stets für Unruhe, Chaos, Orientierungslosigkeit – und das gleich zum Start der Reise. Gerne übrigens in Kombination mit ausgefallenen Sitzplatzreservierungen.
Wer will denn so auf Reisen gehen?!
Beides in Japan praktisch ausgeschlossen. Bereits auf dem Bahngleis ist auf dem Boden in Zahlen und Symbolen genau angegeben, wo sich der verehrte Gast anstellen soll – und genau dort wird der Zug auch halten.
Übrigens: Je nach Zugart mit unterschiedlichen Symbolen auf dem Boden oder mit Extra-Bereichen nur für Frauen.

Frauenfreundlicher Bahnhof in Japan: Eintritt hier nur für Frauen.
Die Orientierung kann wirklich so einfach sein. Fändest du doch selbst super, oder? Die Wagen müssten dazu nur in ihrer ursprünglichen Zahl und Reihenfolge belassen werden. Das kann doch nicht so schwer sein, oder liege ich da etwa falsch?
4. Sauberkeit.
Apropos Warten. Während ich draußen am Bahngleis mit allen anderen wie auf einer Schnur aufgereiht und ohne Ellenbogen-Einsatz darauf warte, in meinen Wagen 4 eingelassen zu werden, wird im Zug selbst noch herumgewuselt. Warum? Die Putzkolonne ist im Einsatz. Jeder startende Zug muss blitzblank sauber sein. Schließlich sollen wir Passagiere uns doch wohl fühlen. Dazu zählt beispielsweise auch, dass alle Japaner ihren – falls vorhandenen – mitgebrachten Müll entweder in die Mülleimer in den Zwischenabteilen werfen oder ihn wieder mitnehmen. Verdreckte Sitzplätze, überquellende Mülleimer, überfüllte Netze – nein, niemals. Aber ich weiß, das ist nicht nur dein Ding. Das ist eher eine Frage an die Kinderstube vieler Mitreisenden …. Wäre das nicht mal eine Kampagne wert, die auch dir selbst einen Mehrwert bieten würde?
5. Bequemlichkeit.

Japanische Bahn: Beinfreiheit im Shinkansen auf dem Weg von Tokyo nach Kyoto
Du bist mir schon viel lieber als die Fluglinien. In deren Ölsardinen-Dosen ist es immer so furchtbar eng. Dein Sardinen-Käfig ist im direkten Vergleich schon etwas bequemer, nur: Saßt du mal auf einem Sitz in einem japanischen Zug? Wie ich in einem Shinkasen von Tokyo nach Kyoto? Hast du dich richtig ausgestreckt? Und es selbst bei deiner enormen Körpergröße nicht geschafft, mit den Knien an den Vordersitz anzustoßen? Ist das nicht ein tolles Gefühl?
Diese Beinfreiheit könnten wir alle in deinem ICE oder sogar einem älteren IC genießen. Du müsstet dich nur bei der nächsten Wagenbestuhlung einfach an den Fenstern orientieren – und ein paar Prozente Profit gegen ein hohes Maß an Glück eintauschen. Dies hätte den schönen Nebeneffekt, dass jeder Gast zum Fenster rausschauen kann und nicht an die Seitenwand blicken muss. Denn das ist doch auch blöd, findest du nicht auch, liebe Bahn?
Mein lieber Freund, es ist auch in Japan nicht alles Gold. Der Kaffee schmeckt genauso übel wie bei euch. Aber Japan ist ja auch Teeland. Beim Kaffee solltest du dich besser an der Schweizer SBB mit Original Lavazza-Kaffee (okay, es gibt leckere Marken) oder an der italienischen Trenitalia orientieren. Die machen die Fahrt zum Kaffee-Genuss … Aber das ist eine andere Geschichte. Und auch WLAN ist in den japanischen Bahnen erst in der nagelneuen Version vorgesehen, die gerade langsam ausgerollt wird. Ach kurze Frage: Wann ist es denn bei dir soweit?
Du liest schon: Es ist wirklich nicht schwer, mich als dein Freund und die vielen anderen glücklich zu stimmen. Du musst es nur wollen. Und wenn du mir zumindest diese kleine Wunschliste erfüllen würdet, dann wäre ich glücklich. Und das willst du doch auch, oder?
Dein Freund Dominik
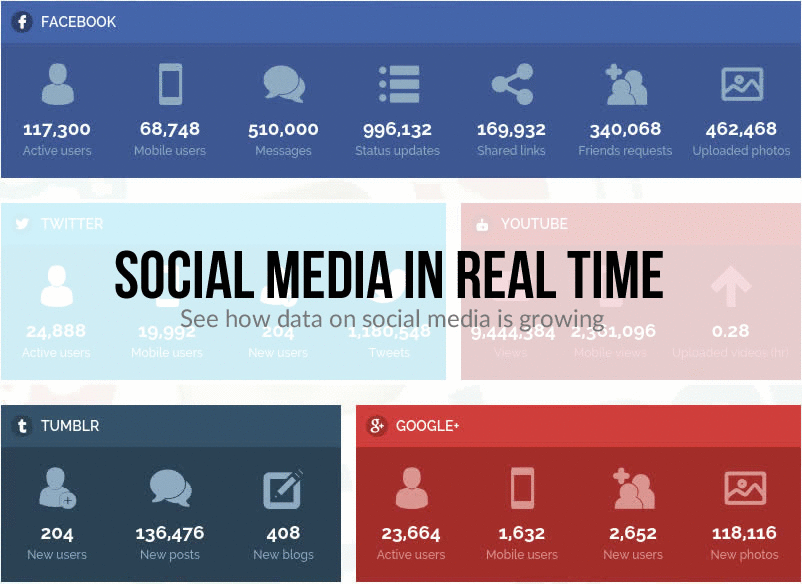
by Dominik Ruisinger | 24.03.2016 | Beiträge
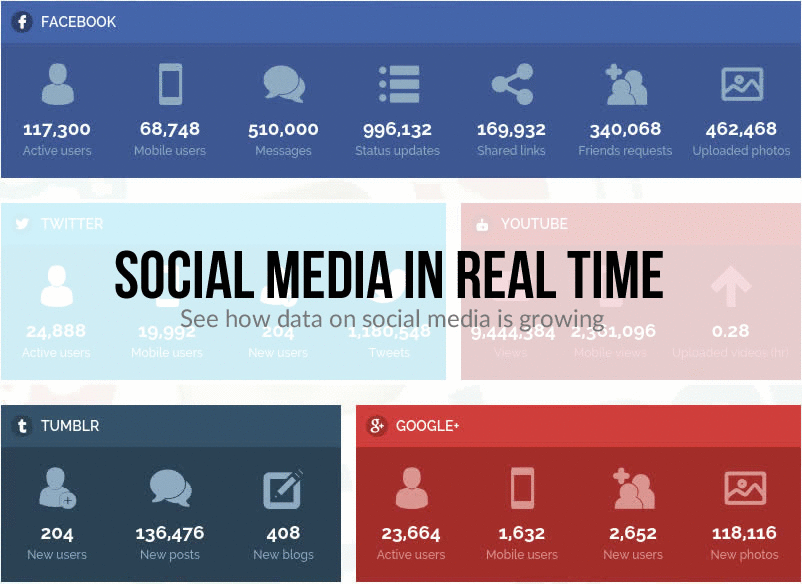
Presented by Coupofy